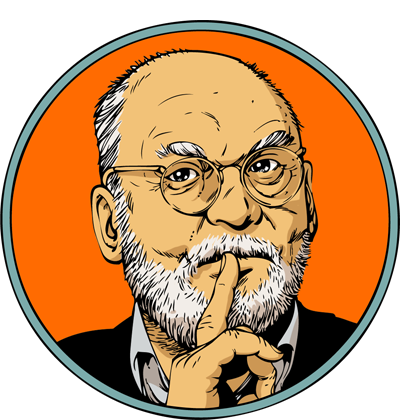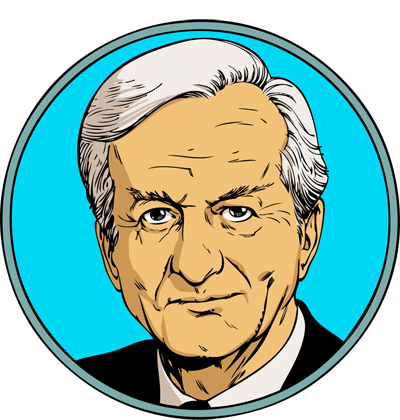Osman Ersoy steht frierend vor dem Hamburger Präsidium. Er hat die letzte Nacht bei der Polizei verbracht - freiwillig und auf Einladung. Der 20-jährige Deutsche, dessen Vater Türke ist, hat sich als Auszubildender bei der Polizei beworben. Heute beginnt das Auswahlverfahren.
Osman lebt mit seiner Familie im nordrhein-westfälischen Münster. Er ist Deutscher, spricht aber auch fließend Türkisch. Das macht ihn als Auszubildenden so interessant. Sprachliche und kulturelle Kompetenzen gehören längst zum Rüstzeug von Polizeibeamten, besonders in Großstädten wie Hamburg, wo fast ein Drittel der Bevölkerung einen Migrationshintergrund hat. Doch auch andere Bundesländer fahnden nach interkulturellem Sachverstand.
Kurz nach halb acht. Die erste Prüfung für die 125 Frauen und Männer ist das Lückendiktat. Muttersprachler sind hier klar im Vorteil. Für Migranten ist der Test oft heikel: Wer patzt, ist draußen. Doch die deutsche Sprache ist unerlässlich für einen Polizisten. Deshalb gibt es auch keine Unterschiede in der Bewertung. "Der hohe Standard des Einstellungstests ist für alle Bewerber gleichermaßen verbindlich", sagt Björn Wichmann, der das Einstellungsverfahren betreut.
"Wir unterstützen die Einstellung von Migranten"
Bundesweit zeigen die Innenministerien ein gestiegenes Interesse an Nachwuchs mit Migrationshintergrund. Sie publizieren dafür Flyer, Anzeigen oder Werbespots. Besonders die Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen haben ihre Bemühungen in der Vergangenheit verstärkt. In Hamburg, das auf eine große Plakatkampagne setzt, hat im laufenden Jahrgang etwa jeder fünfte Auszubildende einen Migrationshintergrund. "Wir unterstützen die Einstellung von Migranten", sagt ein Sprecher des Innensenats. Doch eine konkrete Unterstützung der Bewerber gibt es nicht. Nach dem Gleichstellungsgesetz müssen für alle Bewerber die gleichen Maßstäbe gelten. Auch in Berlin führt am Deutsch-Test führt kein Weg vorbei.
Polizisten haben einen Kommunikationsberuf, meint Norbert Reckers von der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster. Die Beamten träfen "nicht nur auf verschiedene Nationalitäten, sondern kommunizieren auch mit den unterschiedlichsten Bürgern und Behörden." Anzeigen, Berichte oder Meldungen: Deutschkenntnisse seien unerlässlich. Ein Absenken der Standards beim Sprachtest sei kaum vorstellbar.
Doch es ist nicht nur der Sprachtest, der potenzielle Bewerber ausländischer Abstammung abschreckt. "In manchen Kulturkreisen ist der Polizeidienst weniger gut angesehen als bei uns", sagt Wichmann. Deshalb gehen er und seine Kollegen aktiv über Vereine und Verbände auf junge Migranten zu und werben für die Polizei. Bewerberinnen aus dem Orient hätten die meisten Schwierigkeiten, die Anforderungen zu erfüllen: "Das kann an der fehlenden Zustimmung der Eltern oder am versäumten Schwimmunterricht liegen", vermutet Fourouzan Nikurazm. Er ist Integrationsbeauftragter der Gewerkschaft der Polizei in Hamburg: "Viele Eltern wollen auch nicht, dass ihre Töchter mit einem männlichen Kollegen gemeinsam Streife fahren."
"Ich kann mit Polen besser reden als ein Deutscher"
Kurze Prüfungspause. Osman ist unzufrieden mit seiner bisherigen Leistung. "Wie habt Ihr Maurerpolier geschrieben?", fragt er in die Runde. "Mit einem "l" und zusammen", antwortet Tobias Ghyrek. Seine Familie stammt aus Polen und wohnt in Lübeck. Er ist sich der Qualität seiner Zweisprachigkeit bewusst: "Ich kann mit Polen besser reden als ein Deutscher. Ich verstehe auch, wie sie denken."
Osman soll nun einen Bericht schreiben, bei dem Beobachtungsgabe und schriftliche Ausdrucksfähigkeit geprüft werden. Anschließend folgt ein Allgemeinwissenstest und schließlich die Sportprüfung: "Wenn ich es bis dahin schaffe, dann hab ich ein gutes Gefühl."
Enttäuschung auf dem Flur. Osman hat erfahren, dass er im Diktat einen Fehler zu viel hat: Das Aus. Der junge Mann fährt zurück nach Münster. Dort hat er sich ebenfalls bei der Polizei beworben - Hamburg ist nicht das einzige Bundesland, das sich für ihn interessiert.