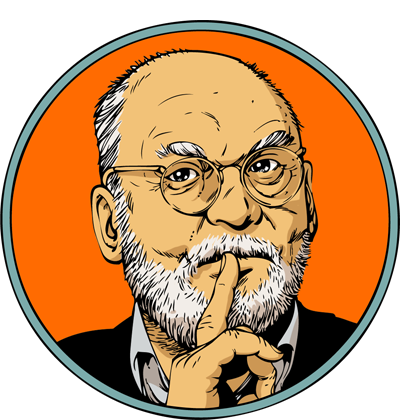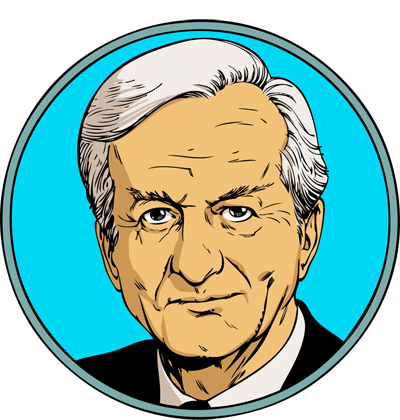Durch wachsenden Wohlstand und zunehmende Individualisierung nimmt die Religiosität in der westlichen Welt einer Studie der Universität Münster zufolge kontinuierlich ab. Dabei verließen die Gläubigen die Kirche weniger aus konkreten Gründen, sondern weil sie ihnen gleichgültig geworden sei, heißt es in einer am Freitag vorgestellten Untersuchung des Münsteraner Religionssoziologen Detlef Pollack. Daher könnten Gegenmaßnahmen der Kirchen wenig gegen diesen Trend ausrichten. Auch alternative, spirituelle Angebote außerhalb der Kirche wie etwa die Esoterik verzeichnen demnach nur schwache Zuwächse.
Neben einem hohen Wohlstandsniveau und zunehmender kultureller Vielfalt wirkt sich laut der Studie auch der Ausbau der Sozial- und Bildungssysteme negativ auf die Religiosität aus. Oftmals bestehe dadurch keine Notwendigkeit mehr, kirchliche Kanäle zu nutzen. In konfessionell eher geschlossenen Ländern wie Polen, Italien oder Irland habe die Religion dagegen nach wie vor einen weitaus höheren Stellenwert als etwa in den religiös pluralen Niederlanden.
Positiver falle die Bilanz für die Religiosität dagegen aus, wenn religiöses Leben in Gemeinschaften eingebettet sei. Auch eine Verbundenheit religiöser Inhalte mit politischen, nationalen oder wirtschaftlichen Interessen könne sich positiv auswirken. Als Beispiele nennen die Autoren Rituale wie etwa die Vereidigung des US-Präsidenten auf die Bibel oder das Gebet im US-amerikanischen Abgeordnetenhaus. Kämen sich Religion und Politik dagegen zu nahe, wachse die Abwehrhaltung der Bürger an. Auch in Gegenden in denen sich Minderheiten gegenüber einer andersgläubigen Mehrheit behaupten müssen, stellten die Forscher eine engere Bindung an die Religion fest.
Für die Untersuchung werteten Pollack und sein Kollege Gergely Rosta den Angaben zufolge Datensätze aus Italien, den Niederlanden, Deutschland, Polen, Russland, den USA, Südkorea und Brasilien seit 1945 aus.
Die Studie ist auch im Buchhandel erhältlich: Detlef Pollack, Gergely Rosta: Religion in der Moderne. Ein internationaler Vergleich ("Religion und Moderne", Band 1), Frankfurt am Main/New York: Campus Verlag 2015, 39,90 Euro.