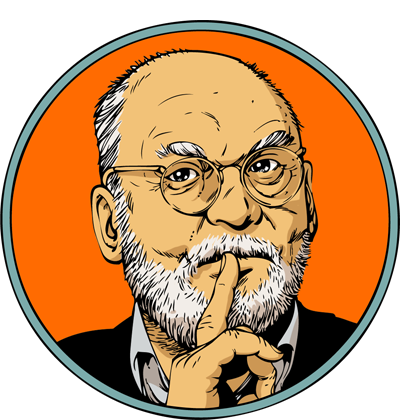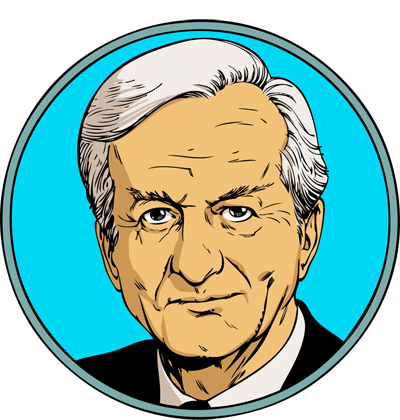Foto: epd-bild/Gerhard Bäuerle
Karteikarten mit den Namen Vermisster im Archiv des Kirchlichen Suchdienstes in Stuttgart (Archiv).
Der Suchdienst war am 1. August 1945 gegründet worden, um deutschen Flüchtlingen und Vertriebenen bei der Suche nach Angehörigen zu helfen und Familien, die auseinandergerissen wurden, wieder zusammenzuführen. Inzwischen erreichen noch rund 6.000 bis 8.000 Anfragen jährlich den Kirchlichen Suchdienst.
Nach Angabe von Hansel hat der Suchdienst in den 70 Jahren seines Bestehens rund 18 Millionen Anfragen bearbeitet. Davon hätten 60 bis 65 Prozent geklärt werden können, sagte der Geschäftsführer. Dazu zählen seinen Angaben zufolge nicht nur Anfragen von Familienangehörigen, sondern auch von Behörden und Erbenermittlern. Die Einrichtung von Diakonie und Caritas wurde ab 1950 vom Bundesinnenministerium gefördert. In den zurückliegenden Jahren erhielt der Kirchliche Suchdienst drei Millionen Euro jährlich vom Bundesinnenministerium.
Im Laufe der Zeit habe sich die Zahl der Vertriebenenanfragen stark verringert, sagte Hansel. Bis zuletzt waren 47 Mitarbeiter an den drei Standorten Passau, Stuttgart und München für den Suchdienst tätig. Passau war bis zuletzt zuständig für Anfragen aus den ehemals deutschen Gebieten Ober- und Niederschlesien sowie aus dem Sudetenland, Stuttgart betreute den früheren Bereich Nordosteuropa, die Bereiche Wartheland-Polen und Mark-Brandenburg sowie Südosteuropa und das Gebiet der ehemaligen Sowjetunion. Die Geschäftsstelle hatte ihren Sitz in München.