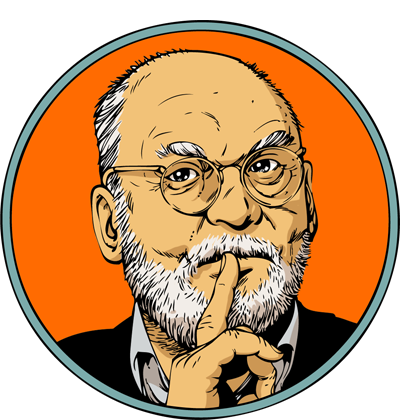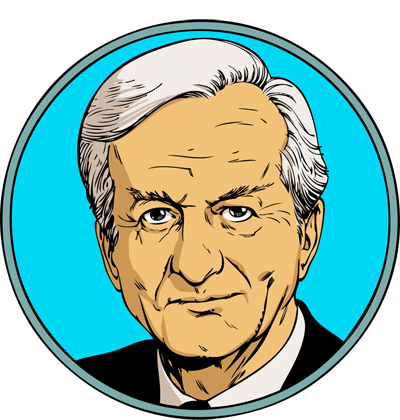Das Gremium wurde am Donnerstag in Berlin von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) konstituiert. Zu Beginn der Sitzung sagte Schäuble: "Wir müssen verstehen, was Künstliche Intelligenz eigentlich ist, was sie zu leisten imstande ist."
KI sei einer der größten Innovationstreiber und werde künftig Rechtsberatung geben, ärztliche Diagnosen stellen, den Aktienhandel managen, Dolmetschen und Dichten, führte Schäuble aus. Es gebe aber auch Warnungen, dass Künstliche Intelligenz die Menschen lückenlos überwachen, belohnen und bestrafen, Arbeitsplätze wegnehmen und Kriege führen werde. Es gehe nun darum, Chancen und Herausforderungen zu verstehen und sicherzustellen, dass auch dieses System künftig den Menschen dienten.
Im Bundestag werden bei schwierigen, gesellschaftlich bedeutenden Themen regelmäßig Enquete-Kommissionen (französisch für "Untersuchung") eingesetzt. Sie ermöglichen es, dass Abgeordnete politisch und sachlich schwierige Themen fraktionsübergreifend gemeinsam mit Sachverständigen, die nicht dem Parlament angehören, erörtern und Empfehlungen erarbeiten. Das Gremium berät in der Regel nicht-öffentlich und wird sich mit Algorithmen befassen wie mit der Würde des Menschen im Web. Es geht aber auch darum, wie Deutschland bei der Digitalisierung aufholen kann.
Ziel der Kommission unter dem Vorsitz der SPD-Politikerin Daniela Kolbe soll es sein, Handlungsempfehlungen zu erarbeiten. Das Gremium aus 19 Abgeordneten und 19 Sachverständigen soll nach der parlamentarischen Sommerpause 2020 den Abschlussbericht vorlegen.
Was ist Künstliche Intelligenz?
Der Begriff Künstliche Intelligenz (KI) wurde vor mehr als 60 Jahren geprägt durch den US-Informatiker John McCarthy. Er stellte einen Antrag für ein Forschungsprojekt zu Maschinen, die Schach spielten, mathematische Probleme lösten und selbstständig lernten. Im Sommer 1956 stellte er seine Erkenntnisse anderen Wissenschaftlern vor. Der britische Mathematiker Alan Turing hatte sechs Jahre zuvor bereits den "Turing Test" entwickelt, der bestimmen kann, ob das Gegenüber ein Mensch ist oder eine Maschine, die sich als Mensch ausgibt.
Doch dauerte es Jahrzehnte, um die KI-Forschung voranzubringen, weil dafür deutlich höhere Rechenleistungen nötig waren. Mitte der 90er Jahre war es soweit und Wissenschaftler widmeten sich Aufgaben wie der Bilderkennung. Nach und nach wurden künstliche neuronale Netze entwickelt, die Informationen wie Sprache und Bilder aufnehmen, Muster erkennen und eigene Lösungen entwickeln: Im vergangenen Februar begrüßte ein Roboter namens "Sophia" die Gäste der Münchner Sicherheitskonferenz, lächelte und antwortete intelligent auf Fragen.
Künstliche Intelligenz ist heute Teil des Alltags, ob als Suchmaschinen, als smarte Sprachassistenten, bei medizinischen Diagnosen oder bei selbstfahrenden Fahrzeugen. Diskutiert wird über Pflege- sowie über Kriegsroboter. Im August debattierten die Vereinten Nationen über den Umgang mit Killerrobotern, die autonom über Militäreinsätze entscheiden.
Der Duden beschreibt Intelligenz als die "Fähigkeit (des Menschen), abstrakt und vernünftig zu denken und daraus zweckvolles Handeln abzuleiten. Künstliche Intelligenz ist demnach die "Fähigkeit bestimmter Computerprogramme, menschliche Intelligenz nachzuahmen."
Was die Lernfähigkeit angeht, ist künstliche Intelligenz schon deutlich weiter: Vor fast einem Jahr avancierte das Google-KI-System AlphaZero ohne Vorkenntnisse nach nur vier Stunden Training zum Schachprofi und besiegte den Computer-Weltmeister Stockfisch. Ein Wettkampf Mensch-Maschine wurde schon vor 20 Jahren entschieden: 1997 verlor der damalige Weltmeister Garry Kasparow gegen ein IBM-Programm.