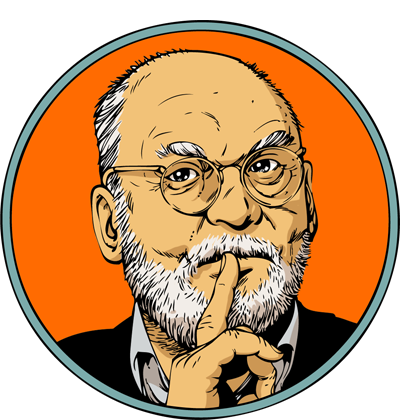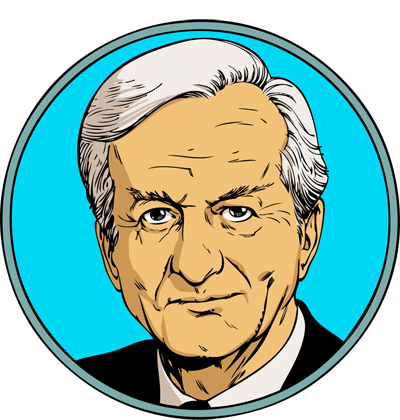© stock.adobe.com/1STunningART
Die Debatten rund um Ökumene und die Bemühungen um den jüdisch-christlichen Dialog sind ein Vermächtnis des 500. Reformationsjubiläums im vergangenen Jahr.
Der jüdisch-christliche Dialog steht vor allem dort im Mittelpunkt, wo die Einführung des Reformationstags als gesetzlicher Feiertag zu Verstimmungen in den jüdischen Gemeinden geführt hat. In Hannover trifft Landesbischof Ralf Meister am Vorabend des Reformationstages den örtlichen Rabbiner Gábor Lengyel bei einer Vortragsreihe "Was gesagt werden muss. Reformation und Judentum". Die Evangelisch-reformierte Kirche lädt ebenfalls am Vorabend des Reformationstages die Rabbinerin der jüdischen Gemeinde Hameln, Ulrike Offenberg, zu einem Vortrag über Juden und Christen in Deutschland ein.
In der niedersächsischen Debatte um die Einführung des Reformationstages als gesetzlicher Feiertag hatte es insbesondere von jüdischer Seite deutliche Ablehnung gegeben. Die jüdischen Gemeinden hatten auf die Judenfeindlichkeit des Reformators Martin Luther hingewiesen. In diesem Jahr ist der Reformationstag in den norddeutschen Bundesländern Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein erstmals gesetzlicher Feiertag, nachdem im vergangenen Jahr anlässlich des Reformationsjubiläums der 31. Oktober ein bundesweiter Feiertag war.
Einen besonderen ökumenischen Gottesdienst gibt es unter anderem in Braunschweig (Niedersachsen). Der katholische Bischof Heiner Wilmer aus Hildesheim predigt im Festgottesdienst im dortigen Dom. Einige Landeskirchen, darunter Oldenburg sowie Hessen und Nassau, verweisen in ihrer Antwort auf die Umfrage auf die ökumenische Schubkraft, die das Reformationsgedenken 2017 gebracht habe. Einen weiteren besonderen Gottesdienst gibt es in Speyer. Aus der dortigen Dreifaltigkeitskirche überträgt die ARD ihren Fernsehgottesdienst. In Speyer steht der Reformationstag im Zeichen von 200 Jahren Pfälzer Kirchenunion. 1818 hatten sich in Kaiserslautern die bis dahin getrennten reformierten und lutherischen Gemeinden der Pfalz zu einer gemeinsamen Kirche vereinigt.
Zwar rechnen die meisten Landeskirchen nicht mit dem Besucherandrang in den Gottesdiensten wie 2017. Aber dort, wo der Reformationstag ein gesetzlicher Feiertag ist, erwartet man immerhin höhere Besucherzahlen im Vergleich zu den Jahren vor 2017. Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, wird am 31. Oktober in Wittenberg sein.
Auch zur Kirchenmusik gibt es größere Veranstaltungen rund um den Reformationstag. Für die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau ist die Uraufführung des zeitgenössischen Luther-Oratoriums "Im Spiegel der Angst" am Samstagabend (20. Oktober) ein Höhepunkt, teilte ein Sprecher mit. In Eisenach hat sich das Bachfest mit dem Reformationsjubiläum etabliert. Vom 26. bis 31. Oktober findet es unter dem Titel "Bach und Mendelssohn" zum zweiten Mal statt.
Der Reformationstag am 31. Oktober ist im Jahr 2018 in neun Bundesländern ein gesetzlicher Feiertag. Die norddeutschen Länder Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein haben den Reformationstag in diesem Jahr zu einem neuen, zusätzlichen gesetzlichen Feiertag erklärt. Im vergangenen Jahr war der 31. Oktober anlässlich des 500. Reformationsjubiläums einmalig ein bundesweiter Feiertag. In Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ist der 31. Oktober seit Jahren arbeitsfrei.
In einigen Bundesländern, etwa in Niedersachsen, hatten sich jüdische Gemeinden und die katholische Kirche gegen diesen Tag als Feiertag ausgesprochen. Die jüdischen Gemeinden verweisen auf die Judenfeindlichkeit des Reformators Martin Luther (1483-1546). Die katholische Kirche sieht in der Kirchenspaltung vor 500 Jahren keinen guten Anlass für einen Feiertag.
2017 feierte die evangelische Kirche 500 Jahre Reformation. 1517 hatte Martin Luther seine 95 Thesen gegen die Missstände der Kirche seiner Zeit veröffentlicht, die er der Überlieferung nach am 31. Oktober an die Tür der Wittenberger Schlosskirche nagelte. Der Thesenanschlag gilt als Ausgangspunkt der weltweiten Reformation, die die Spaltung in evangelische und katholische Kirche zur Folge hatte.