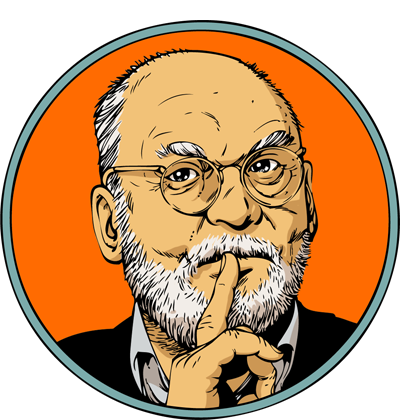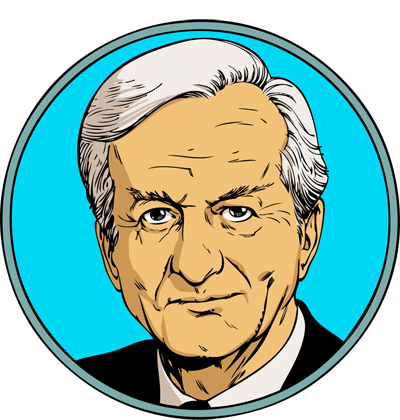Obwohl sie in vielen Verträgen als verbindlich anerkannt worden seien, würden die Menschenrechte bis heute "weltweit vielfach mit Füßen getreten", sagte der Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz am Sonntag laut Manuskript in seiner Predigt in der Berliner Marienkirche.
Mit der Erklärung der Menschenrechte hätten die Vereinten Nationen ein Dokument erschaffen, das ähnlich wie die prophetischen Visionen der Bibel zur Gerechtigkeit ein Hoffnungsbild zeichne, das auch zum Handeln auffordere, betonte Dröge: "Es war eine große Tat, im Jahr 1948 die Menschenrechte zu formulieren, in einer von grausamen Kriegen zerstörten Welt, in der vielen der Glaube an das Gute verloren gegangen war."
Heute erfordere es wieder neuen Mut, die Menschenrechte stark zu machen, betonte Dröge. Der Glaube an eine gute Zukunft der Welt drohe verloren zu gehen, viele Menschen flüchteten sich in persönliche und nationale Egoismen. Deshalb seien Ermutigungen wichtig, sich dafür einzusetzen und daran mitzuwirken, dass die Menschenrechte respektiert werden und Menschen das ihnen zustehende Recht bekommen. Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte wurde am 10. Dezember 1948 von den Vereinten Nationen verkündet. Zu dem Datum wird jährlich der Tag der Menschenrechte begangen.
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte
Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte wird 70 Jahre alt. "Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren", heißt es in dem Dokument, das am 10. Dezember 1948 in Paris von der Vollversammlung der Vereinten Nationen verabschiedet wurde. 48 der damals 56 Mitgliedsländer stimmten für die Erklärung, die unter dem Schock des Nazi-Terrors und des Zweiten Weltkriegs entstanden war. Sechs kommunistische Staaten sowie Südafrika und Saudi-Arabien enthielten sich der Stimme.
Die Erklärung gilt als Meilenstein für den Schutz der Menschenrechte. Sie ist völkerrechtlich nicht verbindlich, setzte aber Normen für unveräußerliche Schutzrechte und Freiheiten, die für alle Menschen überall auf der Welt gelten sollen. Dazu zählen das Recht auf Leben und auf Schutz vor willkürlicher Haft und Diskriminierung, auf Glaubens-, Presse- und Meinungsfreiheit. Um an die Erklärung zu erinnern, wird der 10. Dezember alljährlich als Tag der Menschenrechte begangen. In den Verfassungen vieler Staaten sind die Menschenrechte verankert, auch im Grundgesetz der Bundesrepublik. Auch international wurden verbindliche Konventionen beschlossen. Grundlegend sind der "Internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte und der "Internationale Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte" von 1966, die 1976 in Kraft traten.
Völkerrechtliche Abkommen gibt es etwa auch zu Kinderschutz, Folterverbot und Schutz vor Diskriminierung wegen Rasse oder Geschlecht. Hinzu kommen regionale Abkommen wie die Europäische Menschenrechtskonvention. Trotzdem werden Menschenrechte weltweit weiter verletzt. Männer und Frauen werden willkürlich verhaftet, gefoltert und hingerichtet. Kriegsparteien setzen Hunger und Vergewaltigungen gezielt als Waffen ein. Millionen Kinder müssen unter grausamen Bedingungen arbeiten. Mit dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag, der im Juli 2002 seine Arbeit aufnahm, begann ein neues Kapitel im Schutz der Menschenrechte: Erstmals existiert ein ständiges Tribunal, das Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord ahnden soll.