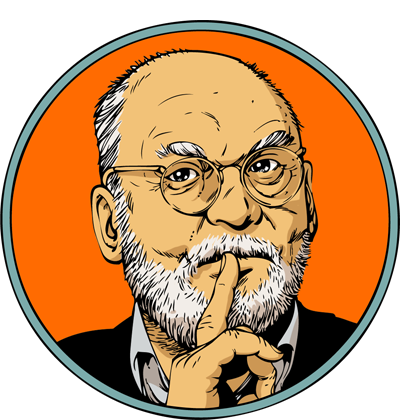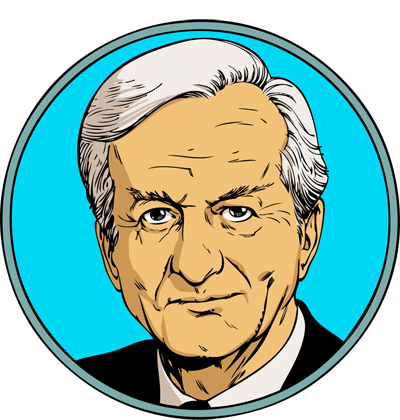© epd-bild/Jens Schulze
Detlev Zander, Sprecher der Betroffenenvertretung des Beteiligungsforums Sexualisierte Gewalt, berichtete dem Kirchenparlament über die Arbeit des Gremiums.
Zander berichtete dem Kirchenparlament über die Arbeit des Beteiligungsforums. Das Forum hatte im Juli seine Arbeit aufgenommen, nachdem die EKD im vergangenen Jahr den kurz zuvor gegründeten Betroffenenbeirat ausgesetzt hatte. Grund dafür waren Streitigkeiten über Rolle und Ausstattung des Gremiums. Daran hatte es viel Kritik gegeben. In dem neuen Forum sitzen 17 Mitglieder, darunter 9 Kirchenvertreter und 8 Betroffene. Für Beschlüsse bedarf es einer doppelten Mehrheit beider Gruppen.
Gestritten worden sei in der Vergangenheit genug, betonte Zander. Nun sei es an der Zeit, dass gemeinsam etwas erreicht werde. Man arbeite im Beteiligungsforum mit den Verantwortlichen der EKD und Diakonie gut zusammen, sagte Zander: "Hart in der Sache, aber fair im Umgang." Bestimmte Sätze möchte er aber von Kirchenvertretern nicht mehr hören. Zum Beispiel "wir haben viel gelernt" oder "wir hören zu". Er verweis darauf, dass Studien keine Aufarbeitung ersetzten. Daher solle man nicht auf weitere Studien warten.
Der Sprecher der Beauftragten im Beteiligungsforum, Landesbischof Christoph Meyns, der seine Funktion zum 1. Dezember an die pfälzische Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst abgeben wird, kündigte an, dass die Ergebnisse der Aufarbeitungsstudie, die seit 2019 läuft, im kommenden Herbst vorliegen sollen. Zudem soll es eine Online-Vernetzungsplattform für Betroffene geben.
Auch eine Grundlage für eine Gemeinsame Erklärung mit der Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung, Kerstin Claus, solle "rasch" geschaffen werden, sagte Meyns.
Die EKD arbeitet seit November 2018 mit dem Unabhängigen Beauftragten zusammen. Für den Bereich der 20 evangelischen Landeskirchen wird eine ähnliche Erklärung angestrebt, wie sie bereits 2020 mit der katholischen Kirche über verbindliche Kriterien für die Aufarbeitung geschlossen wurde. Streitpunkt war bislang die Betroffenenbeteiligung. In der EKD geht man von 757 Betroffenen von sexueller Gewalt in evangelischen Einrichtungen aus. Das Dunkelfeld sei jedoch um ein Vielfaches größer - davon gehen auch die Mitglieder des neuen Forums aus.
Die Gespräche mit Claus' Vorgänger im Amt des Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, Johannes-Wilhelm Rörig, waren jedoch nach der Aussetzung des Betroffenenbeirats weitgehend zum Erliegen gekommen. Claus sprach im Sommer davon, dass eine Erklärung 2023 kommen könnte.
Stichwort: Evangelische Kirche in Deutschland
Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) ist die Gemeinschaft der 20 evangelischen Landeskirchen in der Bundesrepublik mit rund 19,7 Millionen Protestanten. Wichtigste Leitungsgremien sind die EKD-Synode mit 128 Mitgliedern, die Kirchenkonferenz mit Vertretern der Landeskirchen sowie der aus 15 ehrenamtlichen Mitgliedern bestehende Rat. Ratsvorsitzende ist die westfälische Präses Annette Kurschus.
Die EKD wurde 1945 als Zusammenschluss lutherischer, reformierter und unierter Landeskirchen ins Leben gerufen. Die einzelnen Landeskirchen sind selbstständig, die EKD koordiniert jedoch das einheitliche Handeln. Ihre Aufgaben liegen vor allem bei Fragen der öffentlichen Verantwortung der Kirche und bei den Beziehungen zu den Partnerkirchen im Ausland. Zudem ist die EKD zuständig für die Herausgabe der Lutherbibel und des Gesangbuchs. Sie veröffentlicht regelmäßig Denkschriften zu ethischen, sozialen, politischen und theologischen Themen.
Die Teilung Deutschlands hatte 1969 auch für die evangelische Kirche eine organisatorische Trennung zur Folge. Nach der politischen Wiedervereinigung schlossen sich 1991 die evangelischen Kirchen in Ost- und Westdeutschland wieder zusammen. Anfang 2007 wurde eine Strukturreform wirksam, die auf eine enge Verzahnung der Organe und Dienststellen von EKD und konfessionellen Zusammenschlüssen der Lutheraner und Unierten abzielt. Seit 2009 tagen daher EKD-Synode, die lutherische Generalsynode und die Vollkonferenz der unierten Kirchen zeitlich und personell verzahnt am gleichen Ort.
Stichwort: Konfessionelle Bünde in der EKD
Unter dem Dach der EKD gibt es zwei konfessionelle Bünde: In der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD) sind sieben lutherische Landeskirchen mit zusammen rund acht Millionen Gläubigen verbunden. Die Union Evangelischer Kirchen (UEK) wird von zwölf Landeskirchen gebildet, zu denen mehr als zehn Millionen Christen gehören. Diese überwiegend unierten Kirchen gingen aus dem Zusammenschluss reformierter und lutherischer Kirchen im 19. Jahrhundert in Preußen und anderen deutschen Ländern hervor. Die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM) ist Mitglied in beiden Bünden.
Seit einigen Jahren verzahnen die EKD und die beiden konfessionellen Zusammenschlüsse ihre Organe und Dienststellen miteinander, um Kräfte zu bündeln und Doppelstrukturen zu vermeiden. Das sogenannte Verbindungsmodell wurde 2007 wirksam. Seit 2009 tagen die Kirchenparlamente von Lutheranern und Unierten sowie die EKD-Synode jeweils örtlich und zeitlich verbunden sowie personell verzahnt. Auf der Synode 2016 stimmten die Delegierten auch für die Zusammenführung der drei Kirchenämter in Hannover.
Eine Vertiefung der gemeinsamen theologischen Arbeit soll überdies zu einer stärkeren evangelischen Profilierung führen, ohne die Bekenntnisunterschiede zwischen lutherischen, reformierten und unierten Christen in Deutschland zu verwischen. Die Vereinbarungen betreffen die Zusammenarbeit und Aufgabenverteilung zwischen den Kirchenbünden zum Beispiel in den Bereichen Theologie, Liturgie und Ökumene sowie Rechtsangleichungen wie bei den Pfarrdienstgesetzen.