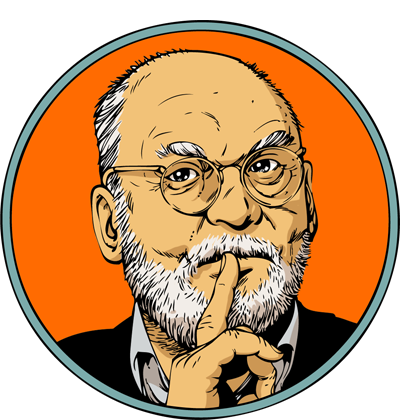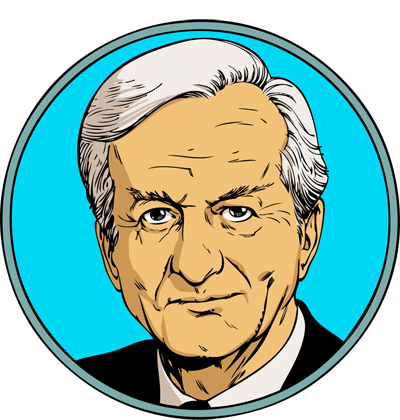© epd-bild/Hans-Jürgen Bauer
Axel Reitz (links) war hoher NPD-Kader in Köln, dann stieg er aus. Eine wichtige Rolle bei seinem Weg aus der Szene spielte der Pfarrer Andrew Schaefer (rechts).
Von Axel Reitz kann man sich Bilder im Internet anschauen, auf denen er im schwarzen Ledermantel und strengem Seitenscheitel auf Demonstrationen spricht. Einst war er einer der führenden Neonazis im Raum Köln. Heute ist er aus der Szene ausgestiegen, engagiert sich für den Verein "Extremislos" und betreibt den Aufklärungskanal "Der Reitz-Effekt" auf Youtube. Extremismus oder Verschwörungsglaube verfügten über ein Lockmittel, erklärt Reitz: Leute kämen in radikale Szenen in der Hoffnung, dass ihre Probleme gelöst würden. "Aber ihr eigentliches Problem, das sie gar nicht erkennen, sind unerfüllte Bedürfnisse."
So sei auch sein Weg in den Extremismus gewesen. "Mein Vater ist ein ziemlicher Diktator zu Hause gewesen", erzählt er. "Ich hatte immer das Gefühl, ich müsste mir Gehör verschaffen, es würde über meinen Kopf hinweg entschieden." In der Schule habe er an einem Referat über Kleinparteien gearbeitet. Seine Lehrerin damals habe ihm untersagt, rechte Parteien zu besprechen. "Das war für mich ein Trigger", sagt der heute 39-Jährige. "Das war wie bei meinem Vater zu Hause, wo meine Argumente auch nicht zählten."
Er habe daraufhin die NPD angeschrieben, die ihn eingeladen und "wärmstens empfangen" habe. Die Leute dort hätten ihm gesagt, der Maulkorb, den er in der Schule erhalten habe, liege "am System" und ihnen gehe es ständig so. "Da war schon mal Grundsympathie da", erinnert sich Reitz. Bis dahin habe er keine politische Präferenz gehabt, sagt er: "Ich hätte auch Salafist oder Autonomer werden können." Er gebe weder seinem Vater noch seiner Lehrerin die Schuld an seiner Radikalisierung, stellt er klar. "Letztlich war ja alles meine eigene Entscheidung."
Schnell stieg Reitz zum führenden Neonazi auf, gründete und leitete eine Kameradschaft. Die Presse nannte ihn "den Hitler von Köln". Wegen Volksverhetzung musste er 2006 für fast zwei Jahre in Haft. Wer in solche Welten abdrifte, fühle sich erst mal gut, erklärt Reitz heute: "Die Leute in diesen Szenen behaupten, sie hätten als einzige die wahren Probleme der Welt erkannt. In der eigenen Wahrnehmung haben sie eine goldene Rüstung an und kämpfen als strahlende Helden gegen das Böse."
Realität und Ideale decken sich nicht
Sein Weg aus dem Extremismus begann allmählich. "Kleine Nadelstiche" nennt er es, wenn sich die Realität in der NPD und postulierte Ideale nicht deckten. Lange habe er sich gegen seine Zweifel gewehrt. Wer sich erst einmal radikalisiert habe, gerate schnell in eine Ausweglosigkeit, beschreibt Reitz. Der Gedankengang sei dann: "Ich kann doch nicht so blöd gewesen sein, obwohl alle mich gewarnt haben. Wie stehe ich denn dann da?"
Als Reitz 2012 erneut in U-Haft kam, entschloss er sich zu einem Schnitt. Die Nachricht über seinen Ausstieg schaffte es damals ins "heute journal". Über einen Journalisten kam ein Kontakt zwischen Reitz und Andrew Schäfer zustande. Der Pfarrer vom Landespfarramt für Weltanschauungsfragen der Evangelischen Kirche im Rheinland mit Sitz in Düsseldorf und der einstige Neonazi sprachen unzählige Stunden miteinander. Über Jahre hinweg.
"Wir haben auch viel gestritten", berichtet Schäfer, weil Reitz nicht von Anfang an seine gesamte Weltsicht aufgab. "Das Entscheidende findet aber gar nicht auf der Sachebene statt", sagt der Pfarrer. "Viel wichtiger ist, ob man Vertrauen zueinander und eine belastbare Beziehung hat. Wenn es das gibt, fängt der andere an, zu glauben, dass ich keinen Mist erzähle."
Also hätten sie viel über Familie, Sorgen und Nöte gesprochen, berichtet Schäfer. So sei Vertrauen gewachsen. Und Reitz habe sich selbst reflektiert.
Jemanden, der sich in extremen Ansichten oder Verschwörungsmythen verloren habe, überzeugen zu wollen, sei die falsche Strategie, sagt Reitz. Er rate Angehörigen solcher Leute dazu, Debatten über Politik höflich abzulehnen: "Viele machen den Fehler und denken, sie könnten dem anderen den Kopf waschen und dann ist der wieder normal." Aber so erhalte der andere nur sein Feindbild aufrecht.
Überzeugungsversuche führten oft genug zu Beziehungsabbrüchen, bestätigt Schäfer. Besser sei es zu schauen, welche Gemeinsamkeiten man noch habe: "Und aus diesen Berührungspunkten können größere Berührungsflächen werden." Schnelle Veränderungen dürfe man dabei nicht erwarten, sagt Reitz: "Niemand steht morgens auf und ist ein neuer Mensch." Man müsse Brücken persönlicher Bindung bauen. Auch wenn es Jahre dauere, ehe der andere diese Brücke überquere.
Wie Menschen sich radikalisieren
Angehörige radikaler Gruppen streben nach Einschätzung von Wissenschaftlern vor allem nach Bedeutung. Die beiden US-Sozialpsychologen Arie Kruglanski und David Webber kommen zu dieser Schlussfolgerung auf der Grundlage von Studien zum Thema. Sie wollen demnach jemand sein, die oder der einen Unterschied macht und in den Augen anderer Menschen bedeutend ist.
Auch wenn Menschen ihre Identität bedroht sehen, kann dies eine Radikalisierung bewirken. Zu radikalen Positionen bezüglich Zuwanderung neigen Studien zufolge vor allem Menschen, die für autoritäre Sichtweisen empfänglich sind.
Außerdem spielen Gruppendynamiken eine Rolle. Geschichten, die innerhalb von Gruppen erzählt werden, liefern Informationen über vermeintliche Ungerechtigkeiten. Die Mitglieder benennen gemeinsame Feinde, die angeblich für diese Ungerechtigkeiten verantwortlich sind und legitimieren verbotene oder unmoralische Mittel zur Behebung der vermeintlichen Ungerechtigkeiten, etwa die Anwendung von Gewalt.
Ebenso kommt es vor, dass eine Gruppe Positionen hat, die radikaler sind als der Durchschnitt der von den einzelnen Mitgliedern vertretenen Ansichten. Dieses Phänomen wird "Gruppenpolarisation" genannt.