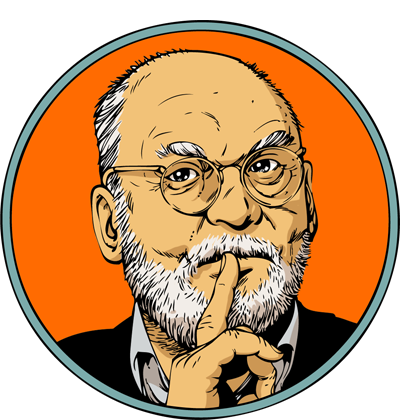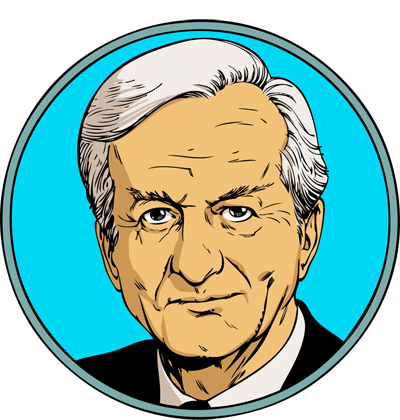© epd-bild/Christian Ditsch
Die Unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung, Ferda Ataman, stellte am Dienstag (18.07.2023) in Berlin ein Grundlagenpapier zur Reform des allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) vor. (Archivbild)
Die unabhängige Antidiskriminierungsbeauftragte des Bundes, Ferda Ataman, erwartet von der Bundesregierung eine gründliche Überarbeitung der Rechtsgrundlagen gegen Diskriminierung. Sie stellte am Dienstag (18.07.2023) in Berlin ein Grundlagenpapier mit ihren Vorschlägen vor. Sie zielen darauf, den Schutz vor Benachteiligungen im Alltagsleben zu erweitern und durchzusetzen.
Ataman sagte, Deutschland habe eines der schwächsten Antidiskriminierungsgesetze in Europa. Die Menschen hätten es schwer, ihre Rechte durchzusetzen. Die Ampel-Koalition plant eine Reform des Gesetzes mit dem Ziel, den Schutz gegen Diskriminierung auszuweiten, hat bisher aber noch keinen Vorschlag vorgelegt.
Grundlage des Diskriminierungsschutzes ist das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG), das nach kontroversen Debatten 2006 eingeführt wurde. Danach darf niemand wegen seines Geschlechts, seiner ethnischen Herkunft, der Religion, einer Behinderung, des Alters, der sexuellen Identität oder aus Gründen der Rasse benachteiligt werden. Damals wurde von den Gegnern des Gesetzes eine Klagewelle befürchtet.
Es ist anders gekommen: Ataman zufolge ergingen seitdem von rund 316.000 Zivil- und Arbeitsgerichtsentscheidungen nur 700 zu Fällen nach dem Gleichbehandlungsgesetz. Demgegenüber geben in Umfragen aber 60 Prozent der repräsentativ Befragten an, schon einmal diskriminiert worden zu sein. Eine klare Mehrheit der Bevölkerung von 88 Prozent hält Diskriminierungsschutz für ein wichtiges Thema. Ataman sprach in Bezug auf die Rechtsdurchsetzung von der "Achillesferse des Gesetzes".
"Hohe Hürde": Indizien für Diskriminierung
Die Beauftragte fordert, die Frist zur Geltendmachung von Ansprüchen wegen Diskriminierung und sexueller Belästigung von zwei auf zwölf Monate zu verlängern und Verbandsklagen zuzulassen. Eine weitere hohe Hürde ist Ataman zufolge, dass jemand, der eine Diskriminierung vor Gericht bringen will, Indizien vorlegen muss. Absagen für Jobs oder Wohnungen werden aber häufig nicht begründet. Daher müsse es ausreichen, dass die Betroffenen glaubhaft machen, dass sie wegen ihrer Hautfarbe, Herkunft oder etwa ihres Alters nicht zum Zuge gekommen seien.
Die Ampel-Koalition will das Gleichbehandlungsgesetz reformieren, um den Rechtsschutz zu verbessern, Schutzlücken zu schließen und den Anwendungsbereich des AGG auszuweiten. Ataman schlägt vor, weitere Merkmale zu prüfen, etwa Benachteiligungen wegen des sozialen Status' oder der Staatsangehörigkeit. Das würde etwa bedeuten, dass ein Vermieter Wohnungsbewerber nicht allein deshalb ausschließen dürfte, weil sie Sozialleistungen empfangen.
Streichung der "Kirchenklausel"?
Ataman dringt auch darauf, die sogenannte Kirchenklausel im Antidiskriminierungsrecht zu streichen. Die Streichung des entsprechenden Paragrafen im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes würde dazu führen, dass die Ausnahmeregelungen für Kirchen eingeschränkt würden. Kirchen und als Körperschaften öffentlichen Rechts anerkannte Religionsgemeinschaften dürfen andere Kriterien an Beschäftigte anlegen als alle anderen Arbeitgeber. Zentral ist, dass die Religionszugehörigkeit entscheidend dafür sein kann, ob eine Bewerberin oder Bewerber in einer kirchlichen Einrichtung beschäftigt wird.
Eine 2016 vorgelegte Evaluation des AGG hatte bereits eine stärkere Differenzierung bei der Kirchenklausel vorgeschlagen. Das Gutachten legte nahe, dass im verkündigungsnahen Bereich Anforderungen an die religiöse Zugehörigkeit gerechtfertigt sein können, für Beschäftigte der Wohlfahrtsverbände der Kirchen wie Ärzte und Erzieherinnen aber die gleichen Regeln gelten sollten wie für Beschäftigte bei weltlichen Arbeitgebern.
Die Evangelische Kirche und katholische Deutsche Bischofskonferenz (DBK) wollten den Ataman-Vorschlag nicht kommentieren. Auf Nachfrage des Evangelischen Pressedienstes (epd) erklärte der DBK-Sprecher, alle Bistümer bis auf zwei hätten das reformierte Arbeitsrecht umgesetzt, wonach die Loyalitätsvorschriften für Beschäftigte in katholischen Einrichtungen im vorigen Jahr gelockert worden waren. Kündigungen sind nur noch bei schweren Verstößen gerechtfertigt, nicht mehr hingegen allein deshalb, weil ein Geschiedener wieder heiratet oder mit einem gleichgeschlechtlichen Partner lebt.
Kirchenklausel
Nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) dürfen Arbeitgeber bei Stellenbesetzungen Bewerber nicht unterschiedlich wegen ihrer Religionszugehörigkeit behandeln. Für Religionsgemeinschaften selbst gibt es aber eine Ausnahme, die in Paragraf 9 des AGG - auch Kirchenklausel genannt - festgelegt ist. Demnach ist eine unterschiedliche Behandlung wegen der Religion oder Weltanschauung zulässig, wenn etwa die Kirchenzugehörigkeit im Hinblick auf das Selbstbestimmungsrecht der Religionsgemeinschaft oder nach Art der Tätigkeit eine "gerechtfertigte berufliche Anforderung darstellt". Unstrittig ist etwa, dass eine Kirche verlangen kann, dass ein von ihr beschäftigter Pfarrer selbst der Kirche angehört. Zunehmend umstritten ist aber, ob diese Voraussetzung auch bei Fachreferentinnen oder Krankenpflegern in jedem Fall gerechtfertigt ist.
Das Bundesarbeitsgericht sprach 2018 einer konfessionslosen Bewerberin, die beim Evangelischen Werk für Diakonie und Entwicklung eine Referentenstelle nicht bekommen hatte, eine Entschädigung zu. Die endgültige Klärung liegt beim Bundesverfassungsgericht.
Eine 2016 vorgelegte Evaluation des 2006 in Kraft getretenen AGG schlug eine stärkere Differenzierung bei der Kirchenklausel vor. Das Gutachten legte nahe, dass im verkündigungsnahen Bereich Anforderungen an die religiöse Zugehörigkeit gerechtfertigt sein können, für Beschäftigte der Wohlfahrtsverbände der Kirchen wie Ärzte und Erzieherinnen aber die gleichen Regeln gelten sollten wie für Beschäftigte bei weltlichen Arbeitgebern.