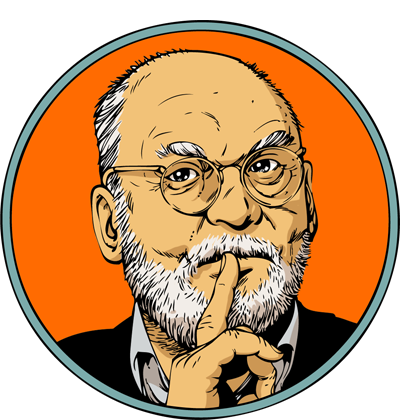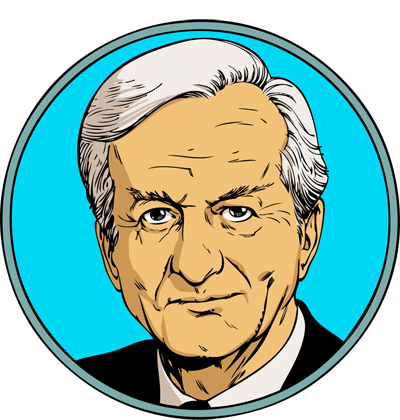© Mechthild Klein (mit freundlicher Genehmigung des Überseemuseum Bremen)
Im Überseemuseum Bremen kann man wie in einem japanischen Schrein Bittkärtchen an den Buddha aufhängen. Die Sonderausstellung läuft bis 28. April 2024.
Der erste Raum der Ausstellung im Bremer Überseemuseum führt in die Grundlagen des Buddhismus ein. Es werden Fragen geklärt wie "Was ist Karma?" oder "Was sind die vier edlen Wahrheiten?" Im nächsten Raum taucht man dann in die Welt der buddhistischen Kunst und Kultur ein.
Insgesamt 250 Kultgegenstände, vorwiegend aus Ostasien, Japan und China, sind zu sehen. Faszinierend ist eine Figur mit 42 Armen, die in alle Richtungen ausgestreckt sind. Das ist die japanische Kannon auf einem goldenen Lotus, ein Erleuchtungswesen, ein Bodhisattva des Mitgefühls. Jede Hand hält ein Symbol für eine der vielen Möglichkeiten, wie dieser buddhistische Helfer den Menschen beistehen kann. Aber auch Mönchsfiguren sind hier zu finden mit ihren Almosenschalen, in gelben oder roten Ordensgewändern.
Dazwischen immer wieder Stupa-Darstellungen: Stupas entwickelten sich aus Grabhügeln. Meist stehen ihre Kuppeln auf einer eckigen Basis mit nach oben spitz zulaufende Türmchen mit Baldachinen – die in die Architektur eingeflossen sind. Stupas sind ein Symbol des Nirvana, erklärt die Kuratorin Renate Noda. Denn auch die sterblichen Überreste des Buddhas wurden nach seiner Einäscherung in Stupas verteilt und "damit ein Reliquienkult ins Leben gesetzt".
Buddhismus ist eine Religion, keine Philosophie
Der Mythos, dass der Buddhismus keine Religion ist, sondern eine Philosophie, wird in dieser Ausstellung widerlegt. Denn schon bald nach Buddhas Tod entstanden Pilgerorte in Indien und Sri Lanka, an denen die Gläubigen die Buddha-Reliquien verehrten.
Hinter Glas stehen nicht nur die kleinen Pagoden und wunderbaren Schreine, sondern vor allem Buddha-Figuren: in Gold glänzend, ausgeschmückt und kostbar. Buddha-Skulpturen aus dem riesigen Pantheon des Mahayana-Buddhismus, einer späteren Schule des Buddhismus, die sich über China nach Japan und Korea verbreitete.
Kannon, Jizo und mächtige Äbte und Äbtissinnen
Die Figur des Kannon taucht gleich mehrfach auf, ursprünglich heißt der Bodhisattva des Mitgefühls auf Sanskrit Avalokiteshvara. In China wird Kannon ab dem 12. Jahrhundert weiblich dargestellt, um auch die Frauen anzusprechen. Dort heißt sie Guanyin und wird besonders als Helferin in der Not verehrt, sagt Renate Noda.
Ähnlich beliebt ist der Jizo, der Bodhisattva für die Verstorbenen im Mahayana-Buddhismus. Oft ist er stehend abgebildet, mit geschorenem Kopf im Pilgergewand, die Proportionen wie ein Kind. In seiner rechten Hand hält er einen Pilgerstab und in der linken ein Wunschjuwel. Er ist sehr wichtig für die Rituale für Verstorbene - in ganz Südostasien.
Jizo ist derjenige, der die Verstorbenen ins Jenseits begleitet, bis vor den Höllenrichter. Wo die Verstorbenen abgeurteilt werden, je nachdem in welche Hölle sie dann wandern müssen. Und er ist auch derjenige, der die Verstorbenen aus der Hölle wieder befreien kann, wenn man ihn verehrt. Jizo hat einen langen Pilgerstab in der Hand. Auch auf Friedhöfen in Deutschland kann man Skulpturen von ihm finden.
Besonders eindrücklich sind in den Vitrinen die recht naturalistischen Abbildungen einst mächtiger Äbte oder Äbtissinnen aus japanischen Klöstern. Aus der japanischen Zen-Kultur sitzt ein lebensgroßer Zen-Meister aus Holz auf einem Thron in vollem Ornat. In der Hand einen Schlagstock für die Meditierenden. Die Zen-Meister seien nach ihrem Tod als Figuren dargestellt worden und dann wie die Buddha-Figuren ebenfalls verehrt worden. "Sie haben auch ihre Opfergaben bekommen", sagt die Kuratorin, die Japanologin und Sinologin ist. "Diese präsenten Darstellungen sollen ihre Buddha-Natur zum Ausdruck bringen, die sie als Zen-Meister erkannt haben sollen."
Buddhistische Medienrevolution im 9. Jahrhundert
"Aus China stammt der vielleicht wichtigste Beitrag des Buddhismus zur Weltkultur", sagt Noda. Hinter den Vitrinen sieht man schwarze hölzerne Buchdruckstanzen auch mit Bildwerken. Es waren chinesische Buddhisten, die zum ersten Mal Holzblock-Buchdruck angewandt haben, um buddhistische Texte zu vervielfältigen. Das Vervielfältigen, vorher auch das Abschreiben von religiösen Texten ist auch mit religiösem Verdienst verbunden. Drucken konnte man sehr viel schneller und das erste gedruckte Buch stammt aus dem 9. Jahrhundert. Doch das kleine hölzerne Wunderwerk geht etwas unter zwischen kostbaren Reiseschreinen und Altären.
Aus Japan stammt auch der rote, grimmig grinsende Höllenrichter Emma-o, den man sich in Gestalt eines Beamten vorgestellt hat. Der sollte den Lohn und die Strafen des Verstorbenen gemäß seines Karma ermitteln. Diese Vorstellung des Beamtenrichters stammt auch China. In Indien hatte der Herr der Unterwelt noch den Namen Yama und so gar nichts Beamtenhaftes an sich.
Im letzten Raum der Buddhismus-Ausstellung können die Besucher und Besucherinnen populäre Buddhist:innen aus der Pop- und TV-Welt kennenlernen, Tina Turner beispielsweise.
Man kann auch wie in japanischen Schreinen auf Kärtchen seine Wünsche aufschreiben und an einer Wand aufhängen. In Bremen ist die Museumswand jedenfalls gut gefüllt mit den goldenen Bitt-Kärtchen. Im Begleitprogramm stellen sich buddhistische Gruppen vor wie beispielsweise der Zen-Kreis Bremen. Der Zen-Lehrer Wolfgang Schmidt war ganz überrascht über das große Interesse und die Geduld der Besucher beim stillen Sitzen. Einmal 20 Minuten nur auf den Atem achten, das ist der erste Schritt.
Die Sonderausstellung "Buddhismus" ist noch bis zum 28. April 2024 im Bremer Überseemuseum direkt zu sehen.